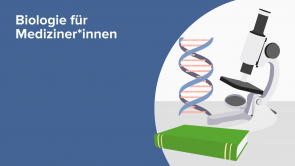Kapitel 6: Grundlagen der Medizinischen Mikrobiologie 1

Über den Vortrag
Der Vortrag „Kapitel 6: Grundlagen der Medizinischen Mikrobiologie 1“ von Dr. rer. nat. Peter Engel ist Bestandteil des Kurses „Biologie für Mediziner*innen (Dr. Engel)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Thematische Einführung / Lebensweisen
- Bakterien (Eigenschaften prokaryontischer Organismen) / Plasmide / Bakterienzellwand
- Lipopolysaccharid (LPS) / Pili / Kapseln / Gramfärbung
- Klassifikation von Bakterien
- Bakterien-Wachstum
- Bakterientoxine / ADP-Ribosylierung
- Ausgewählte Chemotherapeutika
Quiz zum Vortrag
Ein heterotropher Organismus greift auf organische Verbindungen zurück um den eigenen Kohlenstoffbedarf zu decken.
- Richtig
- Falsch
Grüne Pflanzen gehören zu den photoautotrophen Organismen.
- Richtig
- Falsch
Lysozym unterbindet die Quervernetzung des Peptidoglykans von Bakterien.
- Falsch
- Richtig
Bei einer kommensalischen Lebensweise profitieren die zusammen lebenden Organismen gegenseitig voneinander.
- Falsch
- Richtig
Der größte Teil der Bakterien gehören zu den Destruenten.
- Richtig
- Falsch
Carnivoren gehören zu den Konsumenten 1.Ordnung.
- Falsch
- Richtig
Plasmide sind kleine extrachromosomale, einzelsträngige DNA-Moleküle.
- Falsch
- Richtig
Antibiotikaresistenzen können plasmidkodiert sein.
- Richtig
- Falsch
F-Plasmide sind für die Ausbildung der Sex-Pili-verantwortlich.
- Richtig
- Falsch
Teichonsäuren sind typische Bestandteile gram-negativer Bakterien.
- Falsch
- Richtig
Lysozym spaltet die O-glykosidischen Bindungen innerhalb des Peptidoglykans der Bakterien.
- Richtig
- Falsch
Gram-positive Bakterien färben sich bei der Gramfärbung blau-violett.
- Richtig
- Falsch
Staphylokokken und Streptokokken gehören zu den gram-negativen Bakterien.
- Falsch
- Richtig
Coli-Bakterien besitzen im Unterschied zu anderen gram-positiven Bakterien einen noch höheren Mureingehalt.
- Falsch
- Richtig
Der Mureingehalt der Zellwand gram-negativer Bakterien ist höher als der von gram-positiven Bakterien.
- Falsch
- Richtig
LPS wird von gram-negativen Bakterien aktiv sezerniert.
- Falsch
- Richtig
H-Antigene befinden sich in der Geißeln von Bakterien.
- Richtig
- Falsch
Protozoen bilden eine Klasse von gramnegativen Bakterien.
- Falsch
- Richtig
Protozoen-Infektionen lassen sich mit Penicillin behandeln.
- Falsch
- Richtig
Kapseltragende Bakterien lassen sich in der Regel mit der Gramfärbung gut darstellen.
- Falsch
- Richtig
Kapseltragende Bakterien werden durch Makrophagen leichter phagozytiert als kapsellose.
- Falsch
- Richtig
Prokaryonten besitzen eine Zellwand aus Cellulose.
- Falsch
- Richtig
D-Aminosäuren sind an der Quervernetzung des Glykananteils der bakteriellen Zellwand beteiligt.
- Richtig
- Falsch
An der Quervernetzung des Glykananteils bakterieller Zellwände ist die Peptidyltransferase beteiligt.
- Falsch
- Richtig
Im Unterschied zu Pilzsporen, dienen bakterielle Sporen nicht der Überdauerung, sondern der Vermehrung der Bakterien.
- Falsch
- Richtig
Die Geißeln von Bakterien enthalten als Hauptbestandteil Tubuline.
- Falsch
- Richtig
Pili-tragende Bakterien sind in der Lage sich über ihre Pili an Epithelien anzuheften.
- Richtig
- Falsch
Kapsel-tragendende Pneumokokken sind durch eine höhere Pathogenität gekennzeichnet im Vergleich zu kapsellosen Formen.
- Richtig
- Falsch
Diese Kurse könnten Sie interessieren
Kundenrezensionen
4,7 von 5 Sternen
| 5 Sterne |
|
2 |
| 4 Sterne |
|
1 |
| 3 Sterne |
|
0 |
| 2 Sterne |
|
0 |
| 1 Stern |
|
0 |
3 Kundenrezensionen ohne Beschreibung
3 Rezensionen ohne Text
Auszüge aus dem Begleitmaterial
... Ärztliche Prüfung: PhysiKurs 2 - Medizinische Mikrobiologie ...
... Reaktion Chemo-Elektronendonor, organische Verbindung, organo-, anorganischer Stoff ...
... Prüfung: PhysiKurs 4 - Einteilung nach Art der Energiequelle (Chemotroph) ...
... Anorganische Verbindungen als Elektronendonoren zu verwenden, diese also zu oxidieren, werden als lithotroph bezeichnet. Hierzu zählen einige Bakterien. ...
... Prüfung: PhysiKurs 6 - Einteilung nach der Kohlenstoffquelle (Heterotroph) ...
... Protozoen bzw. Protista und Wurminfektionen: Kommensalismus - Ein Organismus (Kommensale, Mitesser) ernährt sich von dem Nahrungsrückstand eines anderen Organismus. ...
... 2. Ordnung - Konsumenten sind durch eine heterotrophe Lebensweise gekennzeichnet. Konsumenten bauen aus organischem Material andere artspezifische organische Verbindungen auf. ...
... Vorteile: - Antibiotikaresistenz - Schwermetallresisitenz - Fertilitätsplasmide (Plasmide werden als Vektoren in der Gentechnologie verwendet) ...
... Bakterienzellwand: die Zellwand ist außen der Zellmembran aufgelagert. Hauptbestandteil ist das Murein (Peptidoglykan). ...
... Mit einer Komponente (Endotoxin) der äußeren Bakterienmembran bindet es sich an CD14 (Oberflächenmolekül) von Makrophagen und Monozyten und aktiviert diese zur Freisetzung von Interleukin-1, Tumor-Nekrose-Faktor-a. ...
... Geißeln sind kurze und starrre Gebilde und dürfen nicht mit Geißeln verwechselt werden. Pili finden sich sowohl bei geißeltragenden als auch bei geißellosen Bakterien. ...
... Virulenzfaktoren: Beispiele sind Pneumokokken und Milzbrandbazillen; die Kapsel ist bei diesen Erregern entscheidend für die Virulenz; die Kapsel schützt die Bakterien vor Phagozytose; kapsellose Pneumokokken sind avirulent. ...
... Ärztliche Prüfung: PhysiKurs 16 - Gramfärbung ...
... Büschelartig (monopolar) - nur an einem Pol; Bipolar - an zwei Polen; Geißeln als H-Antigene ...
... Klassifikation von Bakterien: nach der Gestalt (kugel-, stäbchen- oder schraubenförmig) ...
... Clostridien zählen z.B. zu den Anaerobiern (Cl. botulinum - Lebensmittelvergiftung, Cl. tetani - Tetanus) ...
... Mykoplasmen: Bei den Mykoplasmen handelt es sich um kleine, zellwandlose intrazelluläre Parasiten. ...
... Lag-, log- und stationäre Phase: Bakteriostase und Bakterizidie ...
... Ärztliche Prüfung: PhysiKurs 22 - Bakterientoxine (Endotoxine werden nicht abgegeben) ...
... Gs: Pertussis-Toxin (ADP-Ribosylierung von Gi); Botulinum-Toxin (Botox) -cholinerge Synapsen; Tetanus-Toxin (TeTx) ...
... PhysiKurs 24: ADP-Ribosylierung; G-Protein NAD+; Nikotinsäureamid (Niacinamid); G-Protein ADP-Ribose; Cholera-Pertussis-Diphteria-Toxin ...
... THF-Synthese: Gyrase-Inhibitoren (hemmen die Topoisomerase II der Bakterien); Ciprofloxacin ...
... Ausgewählte Chemotherapeutika: Rifampicin (Hemmung der prokaryontischen RNA-Polymerase); Hemmstoffe der Proteinbiosynthese (Chloramphenicol: Hemmung der Peptidyl-Transferase) ...
... zu den einzelligen Mikroorganismen; es sind entweder Bakterien, Pilze oder Protozoen (Vorsicht! Pilze und Protozoen sind Eukaryonten) - Ein anderer Teil gehört zu den subzellulären Partikeln; dies gilt für Viren und die Prionen. - Schließlich können auch vielzellige Organismen (Metazoen) als Krankheitserreger in Erscheinung treten; hierher gehören die parasitischen Würmer ...
... Parasitische Lebensweise Parasiten sind Organismen, die temporär oder dauerhaft auf Kosten anderer Lebewesen – sogenannter Wirte – zur Befriedigung von Bedürfnissen (Nahrung, Fortpflanzung, usw.) leben. Parasitäre Infektionen beim Menschen sind Infektionen durch Protozoen bzw. Protista und Wurminfektionen. 6.2.5 Kommensalismus Ein Organismus (Kommensale, Mitesser) ernährt sich ...
... zu anorganischem Material abbauen. Pilze und die meisten Bakterien gehören zu den Destruenten 6.3 Bakterien 6.3.1 Die prokaryontische Zelle Bakterien und Blaualgen (Cyanobakterien) werden meist unter dem Begriff Prokaryonten zusammengefasst. Wie im einleitenden Kapitel ZELLBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN beschrieben, unterscheiden sich Pro- und Eukaryonten in vielen wesentlichen Eigenschaften voneinander. An dieser Stelle stehen die spezifischen Eigenschaften der Bakterien im Mittelpunkt.a) Plasmide Plasmide sind extrachromosomale, doppelsträngige DNA-Moleküle, die in Bakterienzellen als "autonome", ringförmig angeordnete Elemente vorliegen und auf denen bestimmte Eigenschaften ...
... Bakterien zeigt einen komplexen Aufbau. Sie besteht aus einer äußeren und einer inneren Membran mit spezifischen Transportproteinen. Den Raum zwischen beiden Membranen bezeichnet man als Periplasmatischer Raum. Dort befindet sich auch das im Falle gram-negativer Bakterien geringer ausgeprägte Mureingerüst. Ein Lipoprotein verankert sie Mikrobiologische Grundlagen Bakterien - Plasmide - Zellwand von Bakterien Lipopolysaccharid (LPS) - LPS besteht aus dem sogenannten Lipid A, einem Phospholipid aus einem Glukosamindisaccharid, das anderen Hydroxyl- und Aminogruppen mit unterschiedlichen Fettsäuren verestert ist. Es stellt eine wesentliche ...
... Pili finden sich sowohl bei geißeltragenden als auch bei geißellosen Bakterien. Es handelt sich um röhrenförmige Gebilde und enthalten u.a. das Protein Pilin. Sie besitzen einen Durchmesser von ca. 5 nm und eine Länge zwischen 0,5 und 5 µm. Den Pili lassen sich zwei wesentliche Funktionen zuordnen: - sie dienen der Anheftung an bestimmte Strukturen auf den Wirtszellen - sie dienen als Sex-Pili zur Anheftung an die F-Stämme) Kapseln Einige Bakterienarten verfügen über zusätzliche, meist dicke und schlecht anfärbbare Schicht, welche die Zellhülle umgibt. Diese Kapsel besteht meist aus einem ...
... der Begeißelung: Bakteriengeißeln sind viel einfacher aufgebaut als die Geißeln von Eukaryonten. Sie bestehen aus einem dünnen Faden von etwa 12 nm und besitzen keine besonderen inneren Strukturen. Bakteriengeißeln enthalten Flagellin als kontraktiles Protein. Nach der Zahl der Geißeln werden bei Bakterien z.B. monotrich (einfach begeißelt) und multitrich (mehrfach begeißelt) begeißelte Formen unterschieden. Bei einer peritrichen Anordnung sind die Geißeln scheinbar zufällig über die ganze Zelle verteilt. Befindet sich eine oder mehrere Geißeln nur an einem Pol, spricht man von einer monopolaren, bei zwei Polen von bipolar. Im Falle einer lophotrichen Anordnung treten ...
... zu den gram-positiven Bakterien (Sepsis, Endokarditis). c) Nach der Fähigkeit, Sporen zu bilden Unter ungüngstigen Lebensbedingungen sind einige Bakterien in der Lage, Dauerformen (Sporen, Endosporen) zu bilden. Bei den Sporen handelt es sich um Zellen mit einem stark herabgesetzten Stoffwechsel (hypomet abolische Zellformen). Sie sind im Gegensatz zu den vegetativen Formen der Bakterien gegen Austrocknung, Hitze (Thermoresistenz) und Chemikalien widerstandsfähig. Gegenüber UV-Strahlen besitzen sie nur eine mäßige Resistenz. Unter den Sporenbildnern finden sich Clostridien und Bazillen. Dabei entsteht aus einem Bakterium auch nur eine Spore. Es sind also Überdauerungs- und ...
... führt eine bakterizide Wirkung zu einem Abtöten der Keime. 6.3.6 Bakterientoxine: Man spricht von Exotoxinen, wenn die Toxine von den Bakterien gebildet und ausgeschieden werden und von Endotoxinen, wenn sie in die Zellmembran eingelagert werden. Bei den Endotoxinen handelt es sich meist um Lipopolysaccharide. Die Exotoxine sind meist mit dem Auftreten einer definierten Krankheit verbunden. a) Diphtheria-Toxin Exotoxin von Corynebakterium diphtheriae, das den eukaryontischen Elongationsfaktor eEF-2 ADP-ribosyliert und damit inaktiviert. Die Proteinbiosynthese kommt zum Stillstand. Die ADP-Ribosylierung erfolgt an einem modifizierten Histidin-Rest, der als Diphthamid bezeichnet wird. b) Cholera-Toxin Es handelt sich hierbei um das Exotoxin von Vibrio cholerae. Durch ADP-Ribosylierung eines spezifischen Arginin-Restes wird die GTPase-Aktivität das aktivierende G-Protein (Gs) außer Kraft ge- ...
... sich anaerob im infizierten Gewebe (Befall von Motoneuronen). Das Toxin führt zu einer Hemmung der Freisetzung von Glycin und GABA. Das Toxin besitzt proteolytische Aktivität. e) Botulinum-Toxin Das Toxin geht auf Clostridium botulinum zurück. Bei diesem Bakterium handelt es sich um einen strengen Anaerobier. Das Toxin hemmt die präsynaptische Freisetzung von Acetylcholin (wirkt auf die peripheren cholinergen Nervenendigungen, incl. der neuromuskulären Verbindungen, der parasympathischen Nervenendigungen und der peripheren Ganglien). Es führt somit zu motorischen Lähmungen. Das Toxin besitzt proteolytische Aktivität. 6.3.7 Ausgewählte Chemotherapeutika Antibiotika und deren Wirkmechanismus a) Hemmstoffe der ...
... Kombination mit Sulfonamiden eingesetzt. c) Gyraseinhibitoren Bei der Gyrase handelt es sich um ein bakterielles Enzym (Topoisomerase II der Bakterien), welches für die Transkription und Replikation der Bakterien-DNA unerlässlich ist. d) Hemmstoffe der bakteriellen RNA-Polymerase Das Rifampicin ist ein Beispiel für einen Wirkstoff, der spezifisch die prokaryontische RNA-Polymerase hemmt. Rifampicin verhindert weder die Bindung der RNA-Polymerase noch die Initiation der RNA-Synthese, ...
... spektrenantibiotika, die an die kleine Untereinheit bakterieller Ribosomen binden und die Assoziation der Aminoacyl-tRNAs unterbinden. Puromycin Das Puromycin ähnelt in seiner Struktur dem 3’-Ende der Tyrosyl-tRNA. Es bindet an die Ribosomale A-Stelle (siehe Biochemie-Script) und wird anstelle einer Aminosäure in die Peptidkette eingebaut. Da keine weitere Verlängerung stattfinden kann, kommt es zu einem Kettenabbruch. Streptomycin Das Streptomycin ist ein Vertreter der medizinisch sehr wichtigen Klasse der Aminoglykosid-Antibiotika. Bei niedrigen Konzentrationen führt ...