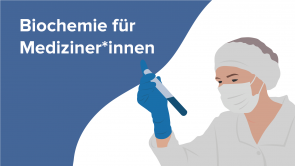Signaltransduktion (1)

Über den Vortrag
Der Vortrag „Signaltransduktion (1)“ von Dr. rer. nat. Peter Engel ist Bestandteil des Kurses „Biochemie für Mediziner*innen (Dr. Engel)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Einleitung
- Rezeptortypen: Intrazelluläre Rezeptoren
- membranständige Rezeptoren
- G-Proteine
Quiz zum Vortrag
Nukleäre Rezeptoren für lipophile Liganden besitzen eine Zinkfingerdomäne.
- Richtig
- Falsch
Die Bindungsstellen von Steroidhormonrezeptoren auf der DNA besitzen oft palindromischen Charakter.
- Richtig
- Falsch
Steroidhormonrezeptoren binden als Homodimere an die DNA.
- Richtig
- Falsch
Retinsäure ist die prosthetische Gruppe des Rhodopsins.
- Falsch
- Richtig
Schilddrüsenhormonrezeptoren gehören zu den ligandgesteuerten Ionenkanälen.
- Falsch
- Richtig
Die Bindungsstellen von intrazellulären Rezeptoren sind oft innerhalb von Enhancerelementen lokalisiert.
- Richtig
- Falsch
Bei den G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) handelt es sich um heterotrimäre, membranständige Proteine.
- Falsch
- Richtig
Die GPCR werden auch als heptahelikale Rezeptoren bezeichnet, da sie über sieben transmembranäre Domänen verfügen.
- Richtig
- Falsch
Die aminoterminale Domäne ist für die Wechselwirkung des GPCR mit G-Proteinen verantwortlich.
- Falsch
- Richtig
GPCR besitzen nur kurzfristige und keine langfristigen Wirkungen.
- Falsch
- Richtig
Die GPCRs sind über G-Proteine mit einem Effektorsystem gekoppelt.
- Richtig
- Falsch
Das Rhodopsin gehört zu den GPCR.
- Richtig
- Falsch
Zu den wichtigsten Effektorsystemen zählen neben der Adenylatcyclase, die Phospholipase Cβ und die cGMP-spezifische Phosphodiesterase.
- Richtig
- Falsch
Das besondere an GPCR sind deren Glykoreste auf der cytoplasmatischen Seite.
- Falsch
- Richtig
Die α-adrenergen gehören zu den GPCR, die beta-adrenergen Rezeptoren zu den ligandgesteuerten Ionenkanälen
- Falsch
- Richig
Die muskarinergen Rezeptoren sind ionotrop, die nikotinergen Rezeptoren sind metabotrop
- Falsch
- Richtig
G-Proteine sind in der Lage GTP hydrolytisch zu spalten.
- Richtig
- Falsch
Die Aktivierung eines G-Proteins erfolgt durch Phosphorylierung des gebundenen GDPs.
- Falsch
- Richtig
G-Proteine sind in den meisten Fällen über Prenylanker in einer Membran verankert.
- Richtig
- Falsch
Der Bindung des Liganden an den zugehörigen GPCR wird ein Nukleotidaustausch an der alpha-Untereinheit provoziert.
- Richtig
- Falsch
Bei den heterotrimären G-Proteinen beeinflusst ausschließlich die alpha-Untereinheit ein Effektorsystem.
- Falsch
- Richtig
Die GTPase-Aktivität ist bei heterotrimären G-Proteinen auf der beta-Untereinheit lokalisiert.
- Falsch
- Richtig
Das Ras-Protein zählt zu den heterotrimären G-Proteinen.
- Falsch
- Richtig
Bei der ADP-Ribosylierung von G-Proteinen wird Niacin freigesetzt.
- Richtig
- Falsch
Das Cholera-Toxin führt zu ADP-Ribosylierung von SNAREs.
- Falsch
- Richtig
Transducin zählt zu den heterotrimären G-Proteinen.
- Richtig
- Falsch
Transducin führt zur Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase.
- Falsch
- Richtig
Das Effektorsystem übernimmt häufig die Funktion eines GAFs (eines GTPase-aktivierenden Faktors).
- Richtig
- Falsch
Diese Kurse könnten Sie interessieren
Kundenrezensionen
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne |
|
5 |
| 4 Sterne |
|
0 |
| 3 Sterne |
|
0 |
| 2 Sterne |
|
0 |
| 1 Stern |
|
0 |
Auszüge aus dem Begleitmaterial
... Ärztlichen Prüfung: PhysiKurs 1 Biochemie Signaltransduktion Teil 1 Allgemeine ...
... und langfristige Effekte aus 10 8.3.1 Beispiele für wichtige Rezeptortypen 10 8.3.4 G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR): 11 8.3.5 G-Proteine (Guaninnukleotid-bindende ...
... Prüfung: PhysiKurs 3 Biochemie 8 Signaltransduktion 8.1 Rezeptortypen ...
... –Vitamin D –Schilddrüsenhormone –Retinsäure Bei den Rezeptoren handelt es sich um Proteine mit einem hohen ...
... 5 Biochemie 8.2 Intrazelluläre Rezeptoren Domänenstruktur eines intrazellulären Rezeptors intrazellulären Rezeptoren sind Ligandabhängige ...
... Strukturen Spezielles Beispiel Hormon (Ligand) Cortisol (Glucocortikoid) Rezeptor Glucocorticoid-Rezeptor (GR) ...
... Biochemie Einige Beispiele Glucocorticoid-abhängiger Gene: Zu den von Glucocortikoiden beeinflussten Genen zählen z.B. ...
... Rezeptoren Startpunkt der Transkription transkribierte Region Ligand /Hormon ...
... Extrazelluläres Signal (1st messenger / 1.Bote) Intrazelluläres Signal kurzfristige Wirkung langfristige Wirkung Aktivierung oder Hemmung ...
... Wichtige Rezeptortypen (Beispiele) ...
... der Ärztlichen Prüfung: PhysiKurs 11 Biochemie ...
... in der cytosolischen Schicht der Plasmamembran verankert; dadurch entsteht vermutlich eine vierte intrazelluläre Schleife. Die Interaktion mit G-Proteinen erfolgt vor allem über die ...
... Prüfung: PhysiKurs 13 Biochemie Aufbau eines 7TM-Rezeptors ...
... bei der Entzündung Plättchen-aktivierender Faktor (PAF) Phospholipid (Plasmalogen) Regulator bei der Immunantwort Leukotrien B4 (LTB4) Arachidonsäure-Derivat Rekrutierung von Leukocyten Interleukin-8 (CXCL-8) Protein Aktivierung von neutrophilen Granulocyten, Angiogenese GCP-2 ...
... GPCR G-Protein-gekoppelter Rezeptor a GDP b g Effektorsystem Heterotrimäres G-Protein 8.1 Rezeptortypen Komponenten Signalkaskade ...
... Zustand: GTP gebunden –inaktiver Zustand: GDP gebunden. G-Proteine durchlaufen einen GTPase-Zyklus, d.h. sie wechseln zwischen dem aktiven und ...
... Prüfung: PhysiKurs 17 Biochemie b) GTPase-Zyklus eines heterotrimeren G-Proteins ...
... PhysiKurs 19 Biochemie Durch Bakterientoxine modifizierte G-Proteine G-Protein Toxin, das ...
... Aktivierung der PLCb Gt Aktivierung einer cGMP spez. PDE Kleine G-Proteine Ras-Proteine Wachstum, Differenzierung, Genexpression Rho/Rac-Proteine Organisation des Zytoskeletts Rab-Proteine Vesikulärer ...
... PhysiKurs 21 Biochemie GPCR Ligand a GDP ...
... Glucocorticoid-Rezeptor (GR) Glucocorticoid-Responsives-Element (GRE) ...
... DNA bindet und die Transkription aktiviert. (C) ... einen Rezeptor, der über ein heterotrimeres G-Protein mit einem Effektorsystem gekoppelt ist (D) ... einen Rezeptor mit Tyrosin-Kinase-Aktivität. (E) ... einen Rezeptor, der Zink in komplexierter Form enthält. 2. Der Wirkmechanismus von Steroidhormonen unterscheidet sich grundsätzlich von ...
... verantwortlich. (E) Sie sind für den Abbau der Exons verantwortlich. 5. Die Phospholipase C führt zur Freisetzung von (A) Adenosinmonophosphat (AMP) (B) Inositoltrisphosphat (IP3) (C) Arachidonsäure (D) Guanosinmonophosphat (GMP) (E) Mannose-6-Phosphat (M6P) 6. Stickstoffmonoxid führt zur Bildung eines second messengers. Dabei handelt es sich um welchen der folgenden ...
... aus dem endoplasmatischen Retikulum in das Zytosol. (B) ..... zur Bildung von Inositoltrisphosphat. (C) ..... zur Relaxation der glatten Muskulatur. (D) ..... zur Aktivierung der Myosin Leichte Ketten Kinase (MLCK). (E) ..... zur Hemmung von Ca2+-ATPasen in der Membran des endoplasmatischen Retikulums. 9. Cortisol ist ein Vertreter der Steroidhormone. Wie lässt sich der Wirkmechanismus der Steroidhormone am besten beschreiben? (A) Steroidhormone gelangen über bestimmte ...
... Regulation der Synthese: die Synthese wird durch ein Zusammenspiel nervaler und hormoneller Reize reguliert ...
... ein Autoimmunprozess zugrunde. (D) Beim Typ I Diabetes verliert das Insulin zunehmend an Wirkung. (E) Der Typ II Diabetes tritt spontan auf und manifestiert sich meist innerhalb weniger Tage. 3. Glucagon ist ein Peptidhormon des Pankreas. Welche Aussage zum Aufbau zur Sekretion und zur Funktion des Glucagons ist richtig? (A) Die Bildung des Glucagons erfolgt in den Alpha-Zellen des endokrinen Pankreas. (B) Glucagon wird wie Adrenalin aus dem Tyrosin gebildet. (C) Primärer Sekretionsreiz ist eine ...
... Pro-Adrenalin. (B) Das Adrenalin wird in der Niere gebildet. (C) Die adrenergen Rezeptoren entfalten ihre Wirkung über heterotrimäre G-Proteine. (D) Cortisol führt zu einer verminderten Synthese des Adrenalins. (E) Adrenalin gehört zu den Hormonen, die proteingebunden im Blut transportiert werden. 6. Insulin ist ein Hormon mit einem komplexen Einfluss auf den Intermediärstoffwechsel. Welche Aussage zur Sekretion und Wirkung des Insulins ist richtig? (A) Insulin gehört zu den Hormonen, die kontinuierlich ans Blut ...
... wird im Nebennierenmark gebildet. (C) Primärer Sekretionsreiz ist ein Abfall des Blutglucose-Spiegels. (D) Glucagon gehört zu den Catecholaminen. (E) Glucagon führt zu einer verstärkten Aufnahme von Glucose in die Fettzelle. 10. Adrenalin zählt zu den lipolytischen Hormonen. Die Aktivierung ...
... den Eigenschaften des Cortisols ist falsch? (A) Die Hauptwirkungen des Cortisols erfolgen über einen intrazellulären Rezeptor. (B) Cortisol wird in der Nebennierenrinde gebildet. (C) Cortisol führt zu einer erhöhten renalen Ausscheidung von Harnstoff. (D) Cortisol führt zu einem ...
... einer Cortisol-Therapie ist mit welcher der folgenden Begleitwirkungen am ehesten zu rechnen? (A) Gewichtsabnahme (B) Hypotonie (C) Vitamin C Mangel ...
... über die Galle und den!Harn ausgeschieden Zelluläre Wirkungen der Androgene: Wie alle Steroidhormone wirken Androgene über einen intrazellulären Rezeptor, der als Ligand-abhängiger Transkriptionsfaktor fungiert (Zinkfingerprotein). Das Testosteron ist maßgeblich am Wachstum und Differenzierung der männlichen Fortpflanzungsorgane(Samenleiter, Prostata, Penis und Vesikulardrüsen) beteiligt. Gleichermaßen ist es für die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale wie Bartwuchs, virile Behaarung, Vergrößerung des Kehlkopfes und Verdickung der Stimmbänder verantwortlich. Androgene stimulieren ebenfalls die Produktion von Erythropoetin. Die Androgene besitzen eine anabole Wirkung und führen somit zu einer positiven Stickstoffbilanz ...
... einer Steigerung der Magnesiumkonzentration im Plasma. (C) einem Abfall der Kaliumkonzentration im Plasma. (D) einem Abfall der Plasmacalciumkonzentration. (E) einer Steigerung des Blutdrucks. 3. Welche der folgenden Aussagen zum Vitamin D ist richtig? (A) Vitamin D wird innerhalb der Leberzellen in Vesikeln gespeichert und bei einem Abfall des Plasmacalciums freigesetzt. (B) Vitamin D ...
... es wird durch wird durch die Endprodukte der Purin-Bildung gehemmt und durch PRPP stimuliert. Die GMP-Synthese wird durch ATP stimuliert, die AMP-Synthese wird durch GTP stimuliert (beide werden aus IMP gebildet) ...
... Azaserin und Desoxynorleucin sind Strukturanaloga des Glutamins und hemmen damit Reaktionen bei denen der Amidstickstoff des Glutamins ...
... es wird in einer enzymatisch katalysierten Reaktion mit einem C-Atom beladen, welches es in einer folgenden Reaktion auf einen Akzeptor übertragen wird ...
... Hyperurikämie und Gicht ? Eine überhöhte Produktion von Harnsäure führt zu einer Hyperuricämie und kann zur Gicht führen. Die Gicht ist durch eine Ablagerung von Harnsäure in den Gelenken, den Schleimbeuteln, den Sehnenscheiden gekennzeichnet. Grundsätzlich wird zwischen einer primären und sekundären Hyperuricämie unterschieden, je nachdem, ob eine Störung des Purinstoffwechsels vorliegt oder nicht. Eine häufige Ursache der primären Form sind auf eine Minderfunktion des tubulären Sekretionssystems zurückzuführen. Ein erhöhter Harnsäurespiegel stellt sich auch bei einer!Minderfunktion der HGPRT ein. Das völlige Fehlen des Enzyms führt zu einer schweren Gicht begleitet von einer Nephrolithiasis. Die Krankheit ist als Lesh-Nyhan-Syndrom bekannt und durch Störungen der geistigen und motorischen Entwicklung, sowie einer ausgeprägten Tendenz zur Selbstverstümmelung gekennzeichnet. Hemmstoffe der Xanthinoxidase, wie das Allopurinol, werden zur Therapie einer Hyperurikämie eingesetzt; darüber hinaus kommen Substanzen zur Anwendung, welche die renale Ausscheidung erhöhen(Uricosurica), in dem sie die tubuläre Rückresorption der Harnsäure unterdrücken (Probenecid)Abbau der Pyrimidinbasen: Im Unterschied zum Purin-Ring lässt sich der Pyrimidinring komplett abbauen. Der anfallende Ammoniak wird im Harnstoffzyklus entsorgg. Die anfallenden C-Atome werden in Kohlendioxid umgewandelt ...
... Cortisol beeinflusst die Aktivität der Cyclooxygenase 2 (COX 2) ...
... der Phase I Reaktionen der Biotransformation werden von Enzymen katalysiert, die im glatten ER lokalisiert sind. (C) Körpereigene Stoffe sind von ...
... der folgenden Aussagen zur Biotransformation ist richtig? (A) Erst nach Biotransformation sind viele Stoffe für den Organismus verfügbar. (B) Hydroxylierungsreaktionen sind typische Phase I Reaktionen. (C) ...
... die Ferrochelatase ist ein mitochondriales Enzym. Sie katalysiert den Einbau eines Fe2+-Ions bei gleichzeitiger Freisetzung von 2 H+-Ionen. Das Ferrochelatase-Gen wird durch Erythropoetin (EPO) induziert.Regulation der HämGBiosynthese: Die Ala-Synthase existiert in zwei verschiedenen Isoenzymformen: die Ala-Synthase-I findet sich in der Leber und die Ala-Synthase-II in den Vorläuferzellen der Erythrocyten. In der Leber erfolgt die Regulation durch allosterische Inhibition der Aminolävulinat-Synthase (Ala-Synthase) durch Häm. Der Transport der Pro-Ala-Synthase vom Cytosol(Ort der Entstehung) in die Mitochondrien (Wirkort). Hemmung der Translation der mRNA u.a. der ALA-Synthase ...
... und wird deshalb in die Galle sezerniert.2. Welche der folgenden Aussagen zum Bilirubin ist richtig? (A) Bilirubin ist ein Abbauprodukt des Häm-Moleküls. (B) Das Bilirubin wird in der Leber vollständig zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. (C) Gallensäuren werden aus Bilirubin gebildet. (D) Eine Mangel an Bilirubin ...
... a)Die Basen sind entweder Purine oder Pyrimidine - aromatische stickstoffhaltige Heterozyklen. Aufgrund der Aromatizität besitzen die Basen eine planare Molekülstruktur ...
... Aufbau des Chromatins Histone: Die eukaryontische DNA liegt im Zellkern in stark kondensierter Form, assoziiert mit Histonproteinen, vor. Es lassen sich 5 Klassen unterscheiden ...
... das Histon H1 ist mit der internukleosomalen DNA assoziiert, die ungefähr 50 Bp lang ist - die 30-nmGFaser. Die nächst höhere Organisationsform ist die 30 nm Faser. Hier sind die einzelnen Nukleosomen dicht miteinander assoziiert. Hieran sind die H1-Moleküle maßgeblich beteiligt, indem sie zu einer helikalen Anordnung ‘polymerisieren’. Die 30 nm Faser bildet schließlich viele Schleifen aus, an deren Bildung Nicht-Histon-Proteine beteiligt sind. Über das weitere Ordnungsprinzip ist derzeit noch sehr wenig bekanntReplikation der DNA - Grundlegende Begriffe; die Replikation (= identische Reduplikation) findet während der S-Phase der Zellteilung statt ...
... das Herausschneiden (‘SPLEISSEN’) dieser Sequenzen erfolgt auf RNA-Ebene. Der Spleiß-Vorgang wird durch die sogenannten snRNPs(small,nuclear,ribonucleoproteoparticles) katalysiert(Spleißosomen). Der Spleißvorgang ist durch eine definierte Abfolge von Umsterungsreaktionen an deren Ende das Zusammenfügen der Exons und die Abspaltung des Introns, die charakteristischerweise in Form eine Lariatstruktur („Lasso“) mit einer 2’-5’-Phosphorsäurediesterbindung enthält. Für die Bildung dieser 2’-5’-Bindung ist eine Verzweigungsstelle erforderlich(in den meisten Fällen ein AMP-Rest in der Nähe der 3’-Spleißstelle. Die Intron-Exon-Grenzen stellen konservierte Regionen dar, die von den Spleißosomen erkannt werden. Es existiert ein „Haupt“-Spleißosom, welches an der weitaus größten Anzahl der Spleißvorgänge beteiligt ist. Es besteht aus den U1&U6-snRNPs. Von großer Bedeutung ist die korrekte Erkennung der Intro-Exon-Grenzen, Mutationen in diesem Bereich führen zu sogenannten Spleißmutationen, die einen sehr großen Anteil an allen Mutationen einnehmen ...
... es existieren verschiedene Formen von alternativem Spleißen, Beispiele sind das „exon-skipping“, bei dem Exons übersprungen werden und damit verloren gehen oder dass unterschiedliche Exon-Intron-Grenzen erkannt werdenProzessierung der ribosomalen RNA: Die Gene eukaryontischer rRNA-Moleküle liegen in zahlreichen Kopien (tandem,repeats) innerhalb des Genoms vor(die Gencluster liegen auf den kurzen Armen von akrozentrischen Chromosomen). Sind in den Nukleoli lokalisiert, wo neben der Transkription der rRNA-Gene auch das Prozessieren und der Zusammenbau der ribosomalen Untereinheiten lokalisiert ist. Sie werden in Form großer Vorläufermoleküle mit einer Sedimentationskonstanten von 45 S synthetisiert ...
... als letztes erfolgen eine Vielzahl spezifischer Basenmodifikationen(u.a. Methylierungen, Veränderungen der Basenstruktur)Hemmstoffe der Transkription a)Actinomycin hemmt in niedriger Konzentration die Transkription, in höherer auch die Replikation. Aufgrund seiner ebenen Struktur ist es in der Lage, sich zwischen übereinander liegenden Basen der DNA (C,G) zu schieben(interkalieren). Es hemmt sowohl prokaryontische als auch eukaryontische Prozesse b)Rifampicin: hemmt spezifisch die RNA&Polymerase von Prokaryonten ...... die entstandene DNA wird in das Wirtsgenom integriert. Die Reverse Transkriptase ist ein wichtiges gentechnologisches Instrument für das Umschreiben von mRNA in cDNA (=komplementäre DNA, d.h. ein DNA-Abschnitt ohne Introns). Schreibt man den gesamten Bestand an mRNAs einer Zelle in cDNA um und kloniert sie in einen Vektor so erhält man eine Bibliothek der aktiven Gene!des analysierten Zelltyps(Genbibliothek) 5' Reaktionszyklus der retroviralen Reversen Transkriptase 3' einzelsträngige ...
... die Signalsequenz („Prä“-Sequenz) zum „Einfädeln“ in das raue ER liegt stets am Aminoterminus ...
... der Prozess ist ebenfalls GTP-abhängig. Zur Regeneration des aktiven Elongationsfaktor-GTP-Komplexes ist ein weiterer Faktor(ein GEF-Austauschfaktor) erforderlich (eEF-1 oder EF-Ts). Die Peptidbindung wird durch eine enzymatische Aktivität auf der großen Untereinheit bewerkstelligt (Peptidyltransferase, 28S-rRNA, Ribozym). Die Aminogruppe der Aminoacyl-tRNA an der A-Stelle wird mit der Carboxylgruppe der Aminosäure an der P-Stelle verknüpft(s.u.). An der P-Stelle sitzt nun eine „freie“ tRNA; an der A-Stelle eine Peptidyl-tRNA. Während der Translokation erfolgt die Verschiebung des Ribosoms um ein Triplett ...
... die Bildung des Initiationskomplexes - Einsatz bei MRSA Tetrazykline blockieren die A-Stelle der kleinen UE = Bindung der neuen Aminoacyl-tRNAs werden verhindert klassischer Vertreter ist ...
... verhindert den Transfer der Aminosäure und damit die Knüpfung der Peptidbindung, Cycloheximid beeinflusst spezifisch eukaryontische Prozesse Diphtherie-Toxin Transferase ...