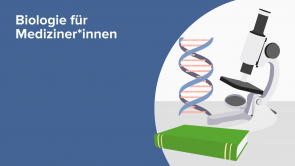Kapitel 3: Zellzyklus und Zellteilung

Über den Vortrag
Der Vortrag „Kapitel 3: Zellzyklus und Zellteilung “ von Dr. rer. nat. Peter Engel ist Bestandteil des Kurses „Biologie für Mediziner*innen (Dr. Engel)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Kontrolle des Zellzyklus
- Cyclinabhängige Kinasen (cdk)
- Apoptose - Nekrose
- Phasen der Mitose
- Meiose
- Keimzellenbildung beim Menschen
Quiz zum Vortrag
Was trifft für Cyclin-abhängige Kinasen (CDK) zu?
- Die Cyclin-abhängigen Kinasen werden in Abhängikeit von der Cyclinkozentration aktiviert.
- Cycline werden während des Zellzyklus kontinuierlich gebildet.
- Bei Aktivierung der CDK4 tritt die Zelle in die M-Phase ein.
- Nach Aktivierung der CDK1 wird die Kernhülle durch Methylierung der Lamine abgebaut.
- Die MPF ist aus drei Untereinheiten aufgebaut.
Welcher Kernstatus liegt in der Mitte der G2-Phase vor?
- 2n4C
- 4n4C
- 1n1C
- 1n2C
- 2n2C
Welche Aussage zum Zellzyklus ist falsch?
- Die DNA-Replikation findet während der gesamten Interphase statt.
- Histone werden in der Interphase synthetisiert.
- Die Mitose ist die kürzeste Phase des Zellzyklus.
- Die S-Phase sowohl länger als die G1-Phase, als auch die G2-Phase.
- Zellen, die nicht mehr mitotisch aktiv sind, überschreiten nach der G1 Phase den Restriktionspunkt.
Das Retinoblastomprotein (pRB)...
- ...unterdrückt im aktiven Zustand die S-Phase.
- ...unterdrückt im inaktiven Zustand die S-Phase.
- ...wird durch Phosphorylierung inaktiv.
- ...wird durch Hyperphosphorylierung aktiv.
- ...wird durch Cyclin-abhängige Kinasen aktiviert.
Was trifft für Apoptose nicht zu?
- Bei der Apoptose wird die DNA willkürlich fragmentiert.
- Bei der Apoptose schrumpft der Zellkern.
- Apoptose ist der programmierte Zelltod.
- Schädigungen der Mitochondrien können Apoptose induzieren.
- Apoptose kann extrinsisch der intrinsisch ausgelöst werden.
Welche Aussage trifft nicht zu?
- Bcl-2 Proteine induzieren die Apoptose.
- Cytochrom C liegt auf der Außenseite der inneren Mitochondrien-Membran.
- Bei einer Nekrose können Ionengradienten der Membran nicht mehr aufrechterhalten werden.
- Caspasen lösen die Zelle von innen heraus auf.
- Caspasen zählen zu den Cysteinproteasen.
Was löst eine Apoptose wahrscheinlich nicht aus?
- Mutationen des p53-Gens
- Schädigung der Mitochondrien
- Das Fehlen von bestimmten extrazellulären Signalen
- Ein irreparabler Schaden der DNA
- Ligandenbindung an einen Rezeptor der TNF-Rezeptorfamilie
Wieso wirkt das Bcl-2 Protein antiapoptotisch?
- Indem das Protein die äußere Mitochondrienmembran stabilisiert, weil es die Freisetzung von Cytochrom C hemmt.
- Indem das Protein Glucocorticoiden die Möglichkeit nimmt extrinsisch Apoptose zu induzieren.
- Indem das Protein die Expression des bax-Gens fördert.
- Indem das Protein die Expression des p53-Gens fördert.
- Indem das Protein Hypoxie induziert.
Was trifft auf p53 nicht zu?
- Die Phosphorylierung von p53 ist GTP-abhängig.
- Es wird physiologischer Weise kontinuierlich in der Zelle gebildet.
- Es wird physiologischer Weise kontinuierlich in der Zelle abgebaut.
- Ubiquitiniliertes p53 wird von der Zelle abgebaut.
- Es wird am G1-Kontrollpunkt aktiviert.
Was findet nicht in der Prophase der Mitose statt?
- Abbau der Kernhülle
- Aufbau des Spindelapparates
- Auflösung des Nukleolus
- Verdopplung des Centromers
- Beginn der Chromosomen-Kondensation
Wann verbinden sich die kinetochoren Mikrotubulifasern mit den Kinetochoren der Chromosomen?
- Vor der Metaphase
- Während der Prophase
- In der G2-Phase
- In der Metaphase
- Während der S-Phase
Was passiert in der Anaphase der Mitose?
- Die Cohesine werden aufgelöst.
- Die Dekondensation der Chromatiden beginnt.
- Die Centromere werden aufgelöst.
- Die Kernhülle wird vollständig abgebaut.
- Das ER bildet sich zurück.
Was passiert bei der Endomitose?
- Die Zelle wird größer.
- Ein Spindelapparat wird ausgebildet.
- Das Kernvolumen bleibt konstant.
- Es entsteht eine diploide Zelle.
- Es gibt keine Replikation.
In welcher Phase der Meiose ist der Chromosomensatz haploid?
- Nach der zweiten Reifeteilung
- Im Leptotän
- Vor der Reduktionsteilung
- Während der Prophase der Meiose I
- Während der S-Phase der Meiose II
Welche Reihenfolge ist korrekt?
- Leptotän-Zygotän-Pachytän-Diplotän-Diakinese
- Leptotän-Pachytän-Zygotän-Diplotän-Diakinese
- Leptotän-Zygotän-Diplotän-Pachytän-Diakinese
- Leptotän-Diplotän-Pachytän-Zygotän-Diakinese
- Leptotän-Diakinese-Pachytän-Zygotän-Diplotän
Was passiert im Diplotän während der Prophase der Meiose I?
- Chiasmata werden sichtbar.
- Die Kernmembran löst sich auf.
- Die Kondensation der Chromatiden beginnt.
- Der synaptonemale Komplex bildet sich.
- Es bilden sich Spindelfasern aus.
Was ist die falsche Aussage?
- Die Oozyte I des Menschen befinden sich zur Geburt in der Prophase der Meiose II.
- In der Metaphasenplatte der Mitose ist jedes Chromosom einzeln angeordnet.
- In der Metaphasenplatte der Meiose werden homologe Chromosomen gepaart.
- Der Kernstatus zu Beginn der Meiose II ist 1n2C.
- Während der gesamten männlichen Geschlechtsreife werden Keimzellen gebildet.
Diese Kurse könnten Sie interessieren
Kundenrezensionen
4,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne |
|
1 |
| 4 Sterne |
|
2 |
| 3 Sterne |
|
1 |
| 2 Sterne |
|
0 |
| 1 Stern |
|
0 |
sehr gut zum WH und auch für Themen die man nicht verstanden hat
3 Kundenrezensionen ohne Beschreibung
3 Rezensionen ohne Text
Auszüge aus dem Begleitmaterial
... Der Zellzyklus lässt sich in zwei Hauptphasen unterteilen: Die M-Phase. Die Interphase. Die M-Phase gliedert sich in die Mitose und die Cytokinese. Während der Mitose erfolgt die Trennung der verdoppelten Chromosomen in zwei Nuklei ...
... der Cyclin-abhängigen Proteinkinasen (CDK). Cycline gehören zu einer Familie von Proteinen, die in bestimmten Phasen des Zellzyklus gebildet werden. ...
... (‘apoptotische Leiter’ nach elektrophoretischer Trennung), Zerfall der Zelle in apoptotische Vesike, Aufnahme der Vesikel durch benachbarte Zellen / Makrophagen – es findet keine Entzündungsreaktion statt, keine Aktivierung des Immunsystems, intrazelluläre Caspase-Kaskade (Cystein-Proteasen, die hinter Asp spalten) ...
... Veränderungen während der Apoptose. Schrumpfen des Zellkerns, Kondensation des Chromatins, Zerfall in Bruchstücke (bleiben von der Kernmembran umgeben). Mitochondrien, das ...
... Nekrose ist durch eine Zellschwellung gekennzeichnet. Verlust der Membranintegrität ...
... inaktiven Vorstufen werden als Pro-Caspasen bezeichnet. Die Aktivierung erfolgt durch limitierte Proteolyse. Man unterscheidet ...
... sind die Caspasen 8 und 9. Sie lagern sich an definierte Proteinkomplexe an und werden dadurch aktiviert. Die Initiator-Caspase 9 wird durch Anlagerung an einen zytosolischen ...
... lösen die Bildung von MOMP aus. tBid Bid tBid lim. Prot. Antiapoptotische Wirkung. Inaktivierung von Bax ...
... Auslösung der Apoptose. Die Apoptose kann durch extrazelluläre (extrinsische) oder intrazelluläre (intrinsische) Signale ...
... reguliert offenbar die Freisetzung von Cytochrom c an der äußeren Mitochondrienmembran. Bcl-2 hemmt diesen Effekt. In Kombination mit Cytochrom c aktiviert ...
... dass die Chromosomen jeweils aus zwei Chromatiden bestehen. Das Cytoskelett löst sich weitestgehend auf, die Spindelfasern beginnen sich auszubilden, die Kernmembran löst sich auf, der Golgi-Komplex und das ER fragmentieren. Die Auflösung der Kernmembran ist ...
... c) Metaphase: Die Chromosomen sind vollständig in der Äquatorialebene angeordnet und die chromosomalen Mikrotubuli sind mit beiden Polen verbunden. Sämtliche Chromosomen sind über ihre Kinetochore mit einer ...
... Die Anaphase beginnt mit der Trennung der beiden Schwesterchromatiden und der Wanderung in Richtung Zellpole. e)Telophase: Die Chromosomen haben die Zellpole erreicht. ...
... Teilung des Cytoplasmas statt. Es entstehen polyploide Kerne. Zunahme des Kernvolumens – gesteigerte Transkriptionsrate –Vergrößerung der Zelle. Amitose: Direkte Kernteilung –Durchschnürung des ...
... Meiose umfasst zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen, wobei haploide Zellen entstehen. Pro Zelle ist nur noch ein homologes Chromosom vorhanden (Reduktion der ...
... erfolgt nach dem Zufallsprinzip (genetische Variabilität). Während der Prophase finden Rekombinationen statt (crossing over, Chiasmata). Zwischen Meiose I und Meiose II findet ...
... besitzen ein perlschnurartiges Aussehen. Die Verdickungen werden als Chromomeren bezeichnet. Die Chromatiden sind noch nicht erkennbar. Zygotän: Kondensation der Chromosomen schreitet fort. Die homologen beginnen sich zu paaren. Pachytän: Die homologen Chromosomen sind vollständig gepaart (Synapsis, ...
... Metaphaseplatte während der Mitose: Die Chromosomen verhalten sich unabhängig voneinander. c) Anaphase I: Die homologen Chromosomen trennen sich unter Auflösung der Chiasmata vollständig und wandern zu ...
... Chromosom besteht bereits aus zwei Chromatiden. Die Zellen sind haploid ...
... Bildung männlicher Keimzellen – während der gesamten Geschlechtsreife – aus einer Spermatocyte entstehen vier reife Keimzellen (Spermien). Bildung weiblicher Keimzellen ...
... Ab dem 3. Embryonalmonat treten die Oogonien in die Meiose I ein (Oocyten 1.Ordnung). Bei der Geburt existieren ca. 2 Mio solcher Zellen. Die Zellen verharren im ...
... in der Regel viel länger als die M-Phase. Die Zyklusdauer einer proliferierenden Zelle beträgt ca. 24 h, wobei 1 h auf die Mitose und 23 h auf die übrigen Phasen – summarisch als Interphase bezeichnet – entfallen. Zur Interphase zählen G 1 (2–20 h), S (6–10 h) und G 2 (2–4 h). G 0, Ruhephase (Übergang aus der G 1-Phase). Die Chromosomen des Zellkerns sind während G 1-, S- und G 2-Phase nicht sichtbar. Vielmehr ist der Kern mit diffusem Chromatin gefüllt. In der klassischen Cytologie wird der Interphasekern auch als Ruhekern bezeichnet, ein Begriff der aus heutiger Sicht aufgrund der hohen Stoffwechselleistungen des Zellkerns nicht mehr zutreffend ist. Die Replikation läuft innerhalb ...
... Rolle des Rb-Proteins in der Zellzykluskontrolle (Rb = Produkt des Retinoblastomgens) Ras stimuliert die Bildung von Cyclin D Cyclin D / CDK4/6 phosphoryliert das Rb Protein und regt die Transkription von Cyclin E an Cyclin E / CDK2 bewirkt die Hyperphosphorylierung von Rb. Rb wird inaktiviert und dadurch E2F aktiviert. E2F führt zur Synthese von Proteinen, die in der S-Phase benötigt werden (DNA Polymerase, DHF-Reduktase, Cyclin A, CDK1 u.v .m) Zellzyklus und Zellteilung Mitose und Cytokinese ...
... benachbarte Zellen / Makrophagen, es findet keine Entzündungsreaktion statt, keine Aktivierung des Immunsystems, intrazelluläre Caspase-Kaskade (Cystein-Proteasen, die hinter Asp spalten); Aktivierung durch limitierte Proteolyse aus Pro-Caspasen. Aktiverung einer CAD = Caspase-aktivierte DNAse. Auslösung durch exogene Faktoren (TNF, Fas-Ligand z.B. auf T 8-Zellen) und intrazelluläre Faktoren ( Cytochrom c ) Morphologische Veränderungen während der Apoptose. Schrumpfen des Zellkerns, Kondensation des Chromatins, Zerfall in Bruchstücke (bleiben von der Kernmembran umgeben). Mitochondrien, das ER und der Golgi-Apparat können zerfallen, einzelne Zellen können sich aus dem Gewebeverband herauslösen. Zerfall der Zelle = Bildung apoptotischer Vesikel. Zellfragmente werden von den benachbarten Zellen aufgenommen, es erfolgt keine unkontrollierte Freisetzung von Entzündungsmediatoren ...
... Apoptose-Proteasen aktivierender Faktor; Bcl-2: B-cell lymphoma; Bax: Bcl-2-assozi- iertes Protein x). Zellzyklus und Zellteilung Apoptose p53, das p53-Protein ist ein homotetramerer zink-haltiger Transkriptionsfaktor, normalerweise ist die p53-Konzentration in der Zelle sehr gering: es wird zwar gebildet, jedoch sofort über den proteasomalen Weg wieder abgebaut (MdM ist eine Ubiquitin-Ligase, die p53 ubiquitiniert) Anoxie, UV -Strahlen und chemische Noxen führen zu einer erhöhten p53 Konzentration, vorrangig durch Hemmung des Abbaus (S teigerung der Aktivität bestimmter Proteinkinasen (z.B. die ATM Kinase), welche u.a. p53 phosphorylieren). Die Phosphorylierung von p53 verhindert dessen ...
... sind. Während der Mitose konzentrieren sich sämtleche zellulären Aktivitäten auf dei Chromosomen-Segregation. Folglich sind dei metabolischen Aktivitäten, incl. der Transkription und der Translation, in dieser Phase auf ein Minimum reduziert. 3.2.1 Phasen der Mitose: Die Mitose wird gewöhnlich in 5 Phasen eingeteilt: a) Prophase, die Chromosomen-Kondensation beginnt; vereinzelt sieht man bereits, dass die Chromosomen jeweils aus zwei Chromatiden bestehen. Das Cytoskelett löst sich weitestgehend auf, die Spindelfasern beginnen sich auszubilden, die Kernmembran löst sich auf, der Golgi-Komplex und das ER fragmentieren. Die Auflösung der Kernmembran ist mit der Phosphorylierung der Lamine durch eine cyclinabhängige Proteinkinase am Ende der ...
... findet nicht statt. Durch Endomitosen ist im Zellkern ein Vielfaches des Chromosomensatzes (polyploide Kerne) entstanden. Dies geht mit einer Zunahme des Kernvolumens und einer erhöhten Transkriptionsrate und einer Vergrößerung der Zelle einher. 3.2.3 Amitose: Bei einer Amitose findet eine direkte Kernteilung statt. Dies erfolgt durch einfache Durchschnürung des Zellkerns und Aufteilung des genetischen Materials ohne vorangehendes Sichtbarwerden der Chromosomen. ...
... der zweiten Reifeteilung (Meiose II/ Äquationsteilung) Voraussetzung für die kontrollierte Verminderung des Chromosomensatzes ist die Paarung der homologen Chromosomen in der Prophase (= Synapsis). Diese trennen sich aber in der darauf folgenden Anaphase wieder und wandern zu den entgegengesetzten Spindelpolen. Folglich erhält jede Tochterzelle nach der ersten Reifeteilung einen kompletten Chromosomensatz. Die Verteilung der mütterlichen und väterlichen Chromosomen erfolgt dabei nach dem Zufallsprinzip. Die zufallsgemäße Verteilung der väterlichen und mütterlichen Chromosomen in der ersten meiotischen Teilung führt zu einer beträchtlichen Variabilität in der genetischen Konstitution der Keimzellen. Die Variabilität führt zu neuen Genotypen und Phänotypen in der Nachkommenschaft. Bevor jedoch die Zellen nach der ersten Reifeteilung zu Gameten differenzieren erfolgt eine weitere Teilung (Äquationsteilung). Da sich ...
... man bezeichnet diesen Zustand als das Tetradenstadium. Überkreuzungsstellen (Chiasmata) der homologen Chromosomen sind erkennbar, die Chiasmata verschieben sich in Richtung der Chromosomenenden: Terminalisierung der Chiasmata Diakinese, hier wird die Kondensation der Chromosomen abgeschlossen, die Kernmembran beginnt sich aufzulösen, die Spindelfasern beginnen sich auszubilden, die Spindelansatzstellen der homologen Chromosomen orientieren sich zu den Polen ...
... vollständig und wandern zu den entgegengesetzten Spindelpolen d) Telophase I, die Dekondensation der Chromosomen beginnt als auch die Ausbildung einer neuen Kernmembran 3.3.3 Ablauf der Meiose II Die Zellen werden allgemein als Meiocyten II bezeichnet. Die Interphase ist in der Regel sehr kurz, unterscheidet sich jedoch dadurch grundsätzlich, dass ...
... permatiden wird zum Kopf des Spermiums. Die Lysosomen werden zum Akrosom. Im Mittelstück befinden sich Mitochondrien, der Axialfaden geht aus den Zentriolen hervor. Der Kernstatus der SpermatocytenI beträgt 2n4C, d.h. die Zellen sind diploid, wobei jedes Chromosom bereits verdoppelt ist und damit aus zwei Chromatiden besteht. Der Kernstatus der Spermatocyten ist demgegenüber 1n2C, d.h. sie sind nur noch haploid, wobei jedes Chromosom aus zwei Chromatiden besteht. Die Spermatiden, welche nach der 2. Reifeteilung gebildet werden, besitzen einen Kernstatus von 1n1C. Bildung weiblicher Keimzellen: Die Urkeimzellen vermehren sich im Embryo durch Mitose und heißen Oogonien. Sie sind bei den Wirbeltieren von einer Epithelschicht umgeben. Vom 3. Embryonalmonat an treten beim Menschen Oogonien in die Reduktionsteilung ein! Man nennt sie ...