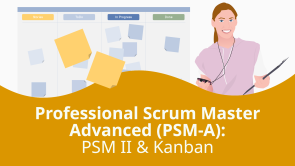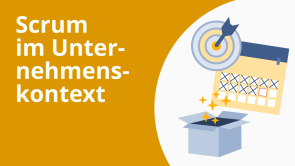Teamtopologien: Teamtypen, Interaktionsmodi und Organisationsstrukturierung

Über den Vortrag
Der Vortrag „Teamtopologien: Teamtypen, Interaktionsmodi und Organisationsstrukturierung“ von Dipl.-Wirtschafts.-Ing(FH), M.Sc. Sebastian Schneider ist Bestandteil des Kurses „Scrum im Unternehmenskontext“.
Quiz zum Vortrag
Welcher der folgenden Teamtypen hat vorrangig das Ziel, andere Teams zu befähigen und Wissen zu übertragen?
- Ein Enabling Team, das Hindernisse adressiert und Wissen weitergibt
- Ein Stream-aligned Team, das kontinuierlich Kundenfunktionen liefert
- Ein Plattform-Team, das Self-Service-Funktionen für andere bereitstellt
- Ein Complicated Subsystem Team, das eine spezialisierte Komponente betreut
- Ein temporäres Projektteam für die Erreichung eines kurzfristigen Ziels
Welche Aussage beschreibt am besten ein Stream-aligned Team?
- Es konzentriert sich primär auf die Entwicklung komplexer, schwer zugänglicher Subsysteme.
- Es hat den Fokus auf einem kontinuierlichen Wertstrom und liefert Funktionen Ende-zu-Ende.
- Es stellt eine interne Plattform mit Self-Service-Diensten für andere Teams bereit.
- Es ist hauptsächlich dafür da, andere Teams temporär zu unterstützen und zu coachen.
- Es arbeitet vollständig isoliert von anderen Teams ohne einen direkten Kundenfokus.
Worin besteht der Hauptzweck von Plattform-Teams?
- Sie stellen Self-Service-Funktionen und APIs bereit, um andere Teams zu beschleunigen.
- Sie entwickeln hochspezialisierte Algorithmen für einzelne, isolierte Systemkomponenten.
- Sie liefern komplette Kundenfunktionen direkt und ohne externe Abhängigkeiten an Endnutzer.
- Sie coachen andere Teams temporär, um deren interne Arbeitsprozesse zu verbessern.
- Sie eliminieren sämtliche Abhängigkeiten zwischen Teams durch eine vollständige Zentralisierung.
Was ist ein typisches Ziel eines Complicated Subsystem Teams?
- Die Bereitstellung von leichtgewichtigen und einfach nutzbaren Self-Service-APIs für Teams
- Das temporäre Befähigen anderer Teams bei der Einführung von vollkommen neuen Praktiken
- Die maximale Anpassungsfähigkeit des Gesamtsystems durch eine möglichst breite Generalisierung
- Die Komplexität durch die Fokussierung auf eine tief spezialisierte Komponente zu reduzieren
- Die Minimierung der teamübergreifenden Kommunikation zugunsten vollständiger Autonomie
Welche Aussage beschreibt die Interaktionsform X-as-a-Service?
- Ein Team stellt eine fertige Dienstleistung oder Plattform bereit, die andere Teams nutzen.
- Zwei Teams arbeiten eng zusammen, um ein gemeinsames, neues Problem zu erforschen.
- Ein Team coacht ein anderes Team temporär, um dessen Fähigkeiten und Wissen aufzubauen.
- Ein Team lagert eine komplette Aufgabe an ein anderes Team aus, um sich zu entlasten.
- Zwei Teams fusionieren vollständig, um ihre jeweiligen Kompetenzen dauerhaft zu bündeln.
Welches Merkmal kennzeichnet die Interaktionsform "Zusammenarbeit"?
- Ein hoher Kommunikationsaufwand durch enge Synchronisation und gemeinsame Problemlösung
- Ein minimaler Kommunikationsaufwand, da hauptsächlich standardisierte Schnittstellen genutzt werden
- Eine rein temporäre Interaktion, die ohne jede langfristige Verbindlichkeit gestaltet ist
- Ein starker Fokus auf Servicebereitstellung ohne gemeinsame, kreative Entdeckungsphasen
- Eine vollständig automatisierte Kommunikation, die gänzlich ohne persönlichen Austausch auskommt
Welche Eigenschaft kennzeichnet die Interaktionsform Unterstützung?
- Sie ist als dauerhafte Interaktion konzipiert und ersetzt alle anderen Interaktionsformen.
- Sie ist temporär und zielt darauf ab, die Fähigkeiten eines anderen Teams gezielt aufzubauen.
- Sie minimiert jegliche Kommunikation und Interaktion zugunsten reiner Self-Service-Modelle.
- Sie impliziert eine enge, fortlaufende Synchronisation zur gemeinsamen Lösung von Problemen.
- Sie bedeutet, dass ein Team die Aufgaben eines anderen Teams vollständig übernimmt.
Welche Maßnahme ist geeignet, um die kognitive Belastung von Teams zu reduzieren?
- Die gezielte Erhöhung der Teamgröße, um ein breiteres Spektrum an Spezialwissen zu integrieren
- Die konsequente Zusammenlegung möglichst vieler Verantwortlichkeiten in einem einzigen, großen Team
- Die Förderung von Selbstbedienungsfähigkeiten, um direkte und dauerhafte Abhängigkeiten zu vermeiden
- Der vollständige Verzicht auf Dokumentation zugunsten einer ausschließlich mündlichen Kommunikation
- Die Einführung verstärkter Multitasking-Anforderungen, um die Effizienz aller Teammitglieder zu steigern
Welche der folgenden Optionen ist KEINE typische Sollbruchlinie zur Definition von Teamgrenzen?
- Unterschiedliche Geschäftsbereiche (Business Domains)
- Verschiedene Technologiestacks oder Plattformen
- Spezifische Userpersonas oder definierte Kundentypen
- Individuelle Präferenzen der Teammitglieder ohne Fachbezug
- Geographische Verteilung der unterschiedlichen Standorte
Was ist ein empfohlener erster Schritt bei der Implementierung von Teamtopologien?
- Eine sofortige Umstrukturierung aller Teams, um schnellstmöglich neue Strukturen zu schaffen
- Die direkte Einführung neuer Interaktionsmodi, um die Zusammenarbeit zu verbessern
- Die Auslagerung aller Plattformfunktionen, um die internen Teams unmittelbar zu entlasten
- Die Festlegung der finalen Erfolgsmessungen, um die Ziele der Transformation klar zu definieren
- Eine Analyse des Ist-Zustands inklusive Visualisierung der Teamstrukturen und Abhängigkeiten
Diese Kurse könnten Sie interessieren
Kundenrezensionen
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne |
|
5 |
| 4 Sterne |
|
0 |
| 3 Sterne |
|
0 |
| 2 Sterne |
|
0 |
| 1 Stern |
|
0 |